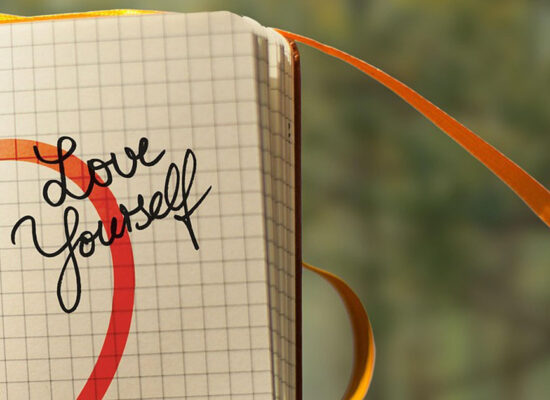Psychomotorik Kongress Bochum: „Mehr als Bewegung“
Am 12. und 13. September 2025 trafen sich rund 300 Fachleute aus Pädagogik, Therapie, Motopädagogik und Bewegungswissenschaft an der Evangelische Hochschule Rheinland‑Westfalen‑Lippe Bochum (EvH Bochum) unter dem Leitthema „Psychomotorik im Dialog – Perspektiven gemeinsam entwickeln“. Mehr als 30 Seminare, Workshops und Vorträge boten Raum für Austausch zwischen Forschung, Praxis und Ausbildung.

Zentrale Fortschritte und Impulse der Psychomotorik
Ganzheitliches Verständnis von Körper, Geist und Emotion
Ein zentrales Thema: Wie Psychomotorik nicht nur Bewegung, sondern Bewegung, Erleben und Beziehung meint. In der Eröffnungs-Keynote betonte Prof. Dr. Renate Zimmer (Universität Osnabrück) die Bedeutung von Resonanz – Kinder benötigen Interaktion und Rückmeldung, damit sie sich wahrgenommen fühlen und sich Entwicklung entfalten kann.
Gleichzeitig reflektierten Fachleute wie Prof. Dr. Stefan Schache (EvH Bochum) und Prof. Dr. Holger Jessel (Hochschule Darmstadt) die interne Vielfalt der Psychomotorik – zwischen Motopädagogik, Ergotherapie, Körperpsychotherapie und sozialpädagogischem Ansatz.
Evidenz, Wirksamkeit und Forschung im Fokus
Ein wichtiger Fortschritt: Die Fachcommunity erkennt stärker, dass Wirksamkeits‑ und Wirkmechanismusstudien nötig sind, damit Psychomotorik langfristig Anerkennung findet (z. B. bei Krankenkassen) und Praxisformate fundiert weiterentwickelt werden können. Allerdings wurde auch thematisiert, wie methodisch anspruchsvoll solche Studien sind – etwa RCTs (randomisierte kontrollierte Studien) sind schwierig in einem ganzheitlichen bewegungsorientierten Setting umzusetzen.
Interdisziplinäre Vernetzung und Praxistransfer
Der Kongress zeigte, wie Psychomotorik verstärkt in Bildung, Frühförderung, Therapie und sozialpädagogische Arbeit eingebunden wird. Es wird nicht länger nur um Spiel und Motorik gehen, sondern um Themen wie Selbstwirksamkeit, Körper‑Leib‑Erleben, soziale Interaktion und emotionale Regulationsfähigkeit. Zudem wurde das Feld internationaler betrachtet: z. B. durch das neue E‑Journal „European Psychomotricity Journal“ unter europäischem Dach.
Zukunftspläne: Wohin steuert die Psychomotorik?
Stärkere Evidenzbasis etablieren
Um langfristig Wirkung und Qualität zu sichern, planen Fach‑, Hochschul‑ und Forschungseinrichtungen vermehrt Studien zur Wirkweise psychomotorischer Interventionen sowie zur Kosten‑Nutzen‑Analyse. Zudem sollen qualitative Ansätze ergänzt werden durch quantitative Daten.
Ausbildung, Qualifikation und Professionalisierung
Die Professionalisierung der Psychomotorik steht auf der Agenda: Einheitlichere Ausbildungsstandards, Qualifikationsrahmen, mögliche Anerkennung in Gesundheits‑ und Rehabilitationssystemen.
Digitalisierung, Hybrid‑Formate und Bewegungsräume neu denken
In einer zunehmend digitalisierten Welt werden neue Umsetzungsformen gefordert: z. B. bewegtes Lernen, virtuelle Bewegungsräume, Sensorik‑Gestützte Bewegungsanalysen – all das wird im Setting von Frühförderung und Schule weiterentwickelt.
Inklusion, Vielfalt und Lebensphasenorientierung
Psychomotorik wird sich noch stärker öffnen für diverse Zielgruppen: Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten (z. B. ADHS, Autismus), ältere Menschen, Menschen mit Migrationserfahrung oder körperlichen Beeinträchtigungen. Ein Fokus liegt auf ressourcenorientierten Ansätzen und barrierefreien Bewegungsangeboten.
Vernetzung mit Bildung, Gesundheit und Soziales
Die Bewegungspädagogik wird Teil größerer Konzepte: Gesundheit, Schulentwicklung, Sozialpädagogik. Psychomotorik will Brücken bauen zwischen Therapieräumen, Kindergarten, Schule und Freizeit. Das war ein zentrales Kongress-Thema: Dialog – Perspektiven gemeinsam entwickeln.
Warum das für Praxis , Therapie und Bildungsarbeit wichtig ist
- Weil Bewegung nicht losgelöst von Beziehung und Gefühl funktioniert – das kindliche Erleben braucht ganzheitliche Ansätze.
- Weil Kinder und Jugendliche Heute mit mehr Risiko‑ und Belastungsfaktoren konfrontiert sind (digital, motorisch, sozial) – Psychomotorik ist hier eine Ressource.
- Weil Fachkräfte (Pädagogik, Therapie, Motopädagogik) Weiterbildung und evidenzbasierte Praxis brauchen, um wirksam zu bleiben.
- Weil Institutionen (Kindergarten, Schule, Jugendhilfe) nach Wege suchen, Bewegungs‑ und Gesundheitsziele effektiv zu integrieren. Psychomotorik verfügt über geeignete Schnittstellen.
Fazit
Der Psychomotorik‑Kongress 2025 war ein deutlicher Schritt nach vorne: weg vom „nur Bewegung machen“, hin zu einem bewegten, gefühlten, relationalen Lernen und Erleben.
Was bleibt: Viel Potenzial – aber auch viel Arbeit – für Forschung, Ausbildung und Praxis. Wer heute in Kindheit, Schule oder Therapie arbeitet, tut gut daran, Psychomotorik neu zu denken: nicht als Zusatzangebot, sondern als integralen Bestandteil von Bewegung, Beziehung und Entwicklung.
Die Workshop-Übersicht und Forschungsideen des Psychomotorik-Kongresses 2025 in Bochum umfassen ein breites Spektrum an praxisnahen und wissenschaftlich fundierten Themen. Das komplette Programm des Psychomotorik Kongress Bochum im Jahr 2025 steht hier zur Verfügung:
Haben Sie Kinder, die professionelle Unterstützung benötigen? Dann nehmen Sie unverbindlich Kontakt zu mir auf. Gerne können wir über Ihre Möglichkeiten sprechen.