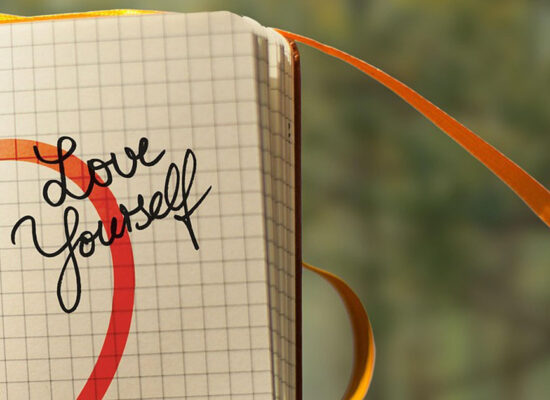ADHS bei Kindern: Zwischen Klischee und Realität
Warum es sich lohnt, genau hinzusehen und wie Eltern authentisch begleiten können
Einleitung: Authentisch Eltern sein
Als Eltern wollen wir Vorbild für unsere Kinder sein und wir wünschen uns Klarheit, Ruhe und Sicherheit. Aber wir wissen auch: Perfekt sein können wir nicht. Vergleiche mit anderen Familien oder Kindern führen oft eher zu Druck und Unzufriedenheit, denn zu Gelassenheit. Viel wichtiger ist: authentisch sein, offen sprechen, reflektieren und lernen, auf das eigene Bauchgefühl und das Herz zu hören.
Wenn nun zusätzlich zu den normalen Herausforderungen des Elternseins die Frage auftaucht: „Hat mein Kind vielleicht ADHS?“, wird alles noch komplexer. Genau zu verstehen, was ADHS eigentlich ist (und was nicht) und was man realistischerweise tun kann, hilft enorm.

Was ist ADHS – und wie hängt es mit „ADS“ zusammen?
Der Begriff ADHS steht für Aufmerksamkeits‑Defizit‑/Hyperaktivitäts‑Störung. Häufig wird im Alltag jedoch auch der Begriff „ADS“ (Aufmerksamkeits‑Defizit‑Störung) verwendet, insbesondere wenn die Hyperaktivität nicht so stark im Vordergrund steht.
Wichtig: ADHS ist nicht nur „Zappeln“, „nicht stillsitzen können“ oder „unartig sein“. Diese Klischees greifen oft aber sie treffen nicht alle zu. Was wir sehen, ist oft nur die Spitze des Eisbergs. Ähnlich wie bei der Autismus‑Spektrum‑Störung gibt es bei ADHS verschiedene Facetten: Verschiedene Subtypen, verschiedene Ausprägungen, unterschiedliche Symptome je nach Kind, Geschlecht, Alter und Umfeld.
Subtypen von ADHS
- Vorwiegend unaufmerksamer Typ (früher häufig als „ADS“ bezeichnet)
- Vorwiegend hyperaktiv‑impulsiver Typ
- Kombinierter Typus – eine Mischung aus beiden
Symptome und Hinweise auf ADHS
Typische Symptome, die bei ADHS auftreten können, sind (nicht vollständig, aber häufig):
- ausgeprägte Bewegungs‑ und Unruhezustände (Hyperaktivität)
- impulsives Verhalten (z. B. handeln, bevor gedacht wird)
- hohe Reizoffenheit, geringe Reizfilterung (z. B. Ablenkbarkeit durch Lärm, andere Kinder)
- Probleme beim Zeitmanagement, Planung und Umsetzung von Handlungsfolgen
- verlangsamtes oder inkonsistentes Arbeitstempo
- Schwierigkeiten, über längere Zeit bei einer Sache zu bleiben, Fokus zu halten
Es gilt: Nicht jede dieser Schwierigkeiten bedeutet automatisch ADHS aber viele dieser Merkmale zusammen, über längere Zeit und über verschiedene Lebensbereiche hinweg, sind Hinweisgeber.
Ist ADHS eine Kinderkrankheit? Ganz und gar nicht!
Lange Zeit war ADHS in vielen Diagnose‑Handbüchern als Störung im Kindes‑ und Jugendalter verankert (z. B. frühere Versionen des ICD‑9 der Weltgesundheitsorganisation). Doch mittlerweile ist klar: Auch Jugendliche und Erwachsene können betroffen sein. Das ist eine sehr wichtige Erkenntnis im Sinne von Verständnis, Unterstützung und langfristiger Begleitung.
Warum eine Diagnose wichtig sein kann
Für viele Eltern bringt eine Diagnose eine Erleichterung: Endlich eine Erklärung dafür, warum das eigene Kind „anders ist“. Und: Endlich der Zugang zu gezielter Unterstützung – für Kind, Familie und Umfeld. Wichtig dabei: Eine Diagnose ist kein Stempel für das Kind („defekt“, „Problemkind“), sondern ein Schlüssel zu Verständnis und Handlungsmöglichkeiten.
Die Diagnostik erfolgt in der Regel über geschulte Psycholog:innen oder Psychiater:innen, mittels standardisierten Kriterien (z. B. DSM‑5), Interviews mit Eltern, gegebenenfalls mit Lehrpersonen, Beobachtungen und Fragebögen. Ein hochwertiger Diagnoseprozess bezieht verschiedene Lebensbereiche mit ein (z. B. Schule, Freizeit, Zuhause).
Geschlecht und ADHS: Mädchen geraten öfter unter dem Radar
Burschen erhalten häufiger eine ADHS‑Diagnose als Mädchen und das hat gute Gründe.
- Bei Jungen treten häufiger äußere Verhaltensauffälligkeiten auf (z. B. Regelbrechen, Impulsivität, Risiken eingehen) diese führen sichtbarer zur Diagnosestellung.
- Mädchen hingegen zeigen oft innere Symptome (z. B. Tagträumen, Rückzug, Ängste, somatische Beschwerden) und sind im Unterricht oft unauffälliger deshalb fällt die Störung seltener auf.
- Mädchen sind oft sozial geschickter und können zusätzliche Anstrengung investieren, um „mitzumachen“. Dennoch kostet sie das viel Energie und das Selbstwertgefühl kann leiden.
Studien zeigen z.B., dass in einer großen schwedischen Stichprobe die klinisch diagnostizierte ADHS bei Mädchen bei ~1,88 % lag vs. ~4,65 % bei Jungen. In einer internationalen Metaanalyse wurde eine weltweite Prävalenz von ca. 8 % bei Kindern und Jugendlichen geschätzt – wobei Jungen etwa doppelt so häufig betroffen waren wie Mädchen (ca. 10 % vs. 5 %). Das heißt: Auch wenn Mädchen seltener erkannt werden heißt das nicht, dass sie weniger betroffen sind oder weniger leiden.
Haben Sie Kinder, die professionelle Unterstützung benötigen? Dann nehmen Sie unverbindlich Kontakt zu mir auf. Gerne können wir über Ihre Möglichkeiten sprechen.
Studienlage: Zahlen und Erkenntnisse im Überblick
- Laut einer Datenanalyse der US‑Behörde für Gesundheit (NHIS 2020–2022) wurde bei Kindern im Alter 5–17 Jahren eine Lebenszeit‑Diagnose von ADHS bei 11,3 % angegeben. Jungen: 14,5 %; Mädchen: 8,0 %. Zentrum für Krankheitskontrolle
- In einer systematischen Meta‑Analyse lag die globale Prävalenz bei Kindern und Jugendlichen bei etwa 8,0 % (Konfidenzintervall 6–10 %). Jungen deutlich häufiger betroffen. PubMed
- In Iran zeigte eine Metaanalyse bei Grundschulkindern eine ADHS‑Prävalenz von 11,2 %, mit Jungen 10,1 % vs. Mädchen 7,0 %. PubMed
Diese Daten zeigen: ADHS ist keine Seltenheit – und dennoch werden viele Fälle möglicherweise nicht erkannt bzw. fehlinterpretiert.
Umgang mit Kindern: Tipps für Eltern, Familie und Umfeld
Wenn bei Ihrem Kind möglicherweise ADHS eine Rolle spielt oder Sie beobachtete Hinweise haben, können folgende Ansätze helfen:
Haltung und Kommunikation
- Vermeiden Sie Schuldzuweisungen ADHS ist nicht Ausdruck schlechter Elternschaft, fehlender Grenzen oder mangelnder Erziehung.
- Sehen Sie das Kind mit seinen Stärken und Herausforderungen nicht als „Problem“.
- Informieren Sie sich selbst, sprechen Sie offen mit Ihrem Kind (altersgerecht) darüber, was bei ihm anders läuft.
Umfeld einbeziehen
- Kindergarten, Schule und Betreuungspersonen informieren und beteiligen. Oft werden Probleme fälschlich als „Stören“ interpretiert, statt erkannt, dass z. B. Reizüberflutung oder Konzentrationsprobleme vorliegen.
- Verantwortlichkeiten im Alltag schaffen: Das Kind bekommt Aufgaben, die seiner Entwicklungsstufe entsprechen, in denen es wachsen kann.
- Struktur und Klarheit helfen: sichtbare Tagesabläufe, Reizreduktion (z. B. ruhiger Arbeitsplatz, weniger zusätzliche Geräusche/Lärm) und gezielte Aufmerksamkeit auf Übergänge.
Emotionale Impulse verstehen
- Wenn ein Kind impulsiv reagiert oder aggressiv wird, gilt es zu verstehen: Es handelt sich oft um eine Überforderung nicht um „böses“ Verhalten.
- Kinder mit ADHS haben häufig Schwierigkeiten mit der Steuerung von Emotionen hier braucht es Unterstützung, nicht nur Konsequenzen.
- Familien‑ bzw. Elterncoaching kann helfen, gemeinsam Strategien zu entwickeln.
Therapie‑/Unterstützungsansätze
- Körperorientierte Ansätze (z. B. Psychomotorik), Bewegung, Yoga, Achtsamkeits‑Übungen können hilfreich sein.
- Sozial‑,Emotions‑ und Kompetenztrainings für Kinder.
- Elternberatung und ggf. Selbsthilfegruppen.
- In manchen Fällen: ärztliche Abklärung und ggf. medikamentöse Unterstützung – immer individuell und sorgfältig abwägen.
Wenn Sie Interesse an einer Sozialen Kompetenz Gruppe haben, dann kontaktieren Sie mich einfach und unverbindlich.
Schlusswort: Vertrauen schaffen statt vergleichen
Eltern eines Kindes mit ADHS Hinweisen leisten jeden Tag Großes. Wichtig ist, sich nicht an anderen zu messen, sondern das eigene Kind anzusehen mit seinen Besonderheiten, seinem Tempo, seinen Bedürfnissen. In einer Welt, die sich oft am Vergleich orientiert, ist das ein mutiger Schritt.
Elternschaft bedeutet nicht Perfektion, sie bedeutet: Beziehung, Verständnis, Wachstum. Und wenn das Kind anders ist, dann ist das nicht ein Makel, sondern eine Einladung, tiefer hinzusehen, konstruktiv zu begleiten und gemeinsam Stärke zu entwickeln.
Die Diagnose ADHS ist kein Endpunkt, sie kann der Anfang einer positiven Veränderung sein: Mehr Verständnis, bessere Unterstützung, stärkere Resilienz für das Kind und die ganze Familie.